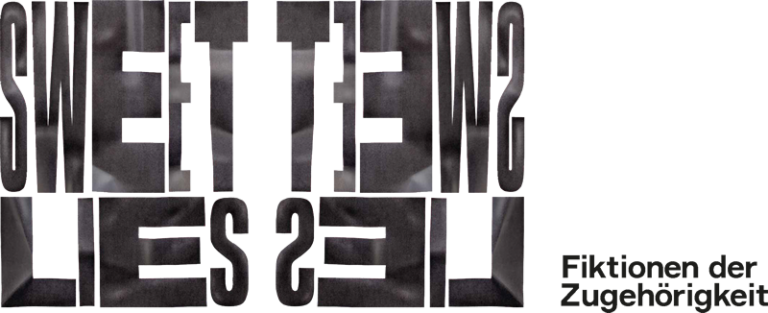Robert Morris
* 1931 in Kansas City (MO), USA
† 2018 in Kingston (NY), USA

Zum Pionier des Minimalismus avanciert Robert Morris ab den 1960er-Jahren mit Werken, die auf ihre geometrischen Grundformen reduziert sind. Dabei spielen spiegelnde Oberflächen eine entscheidende Rolle. Durch den Einsatz des Parabolspiegels erreicht Morris eine Spiegelglasverformung, die Betrachter*innen gleichermaßen irritiert wie zur Interaktion mit dem Objekt auffordert. Nie ist es möglich, dass die Arbeit bei mehrmaliger Betrachtung genau gleich aussieht, mit jedem Beschauen ändert sie ihr Erscheinungsbild. Dabei vermag es das Objekt, den Umraum in sich aufzunehmen und damit ein verzerrtes Bild der Umwelt zurückzuwerfen, um diese schließlich neu erlebbar zu machen.
Das Gleiche gilt für die Betrachter*innen, womit die Suche nach persönlichen und kollektiven Identitäten eingeleitet wird. Das verzerrte Spiegelbild wird zum Ausgangspunkt der Subjektwerdung und Selbstverortung. Es kann als Metapher dienen, in der sich das Individuum als Subjekt selbst reproduziert. Dabei liegt der Fokus auf der Welt der (Selbst-)Bilder und damit verbundenen Projektionen. Erst im Diskurs zwischen dem Subjekt und seiner Umwelt kann sich das Individuum ausbilden. Dabei definieren wir unsere persönlichen Identitäten nicht nur durch die Zugehörigkeit zu anderen Gruppen, die uns ähnlich sind, sondern auch in Abgrenzung zu anderen. Unsere Identitäten sind also abhängig von Identifizierungen durch und mit anderen. Dies gelingt nur durch eine Form der Selbstreflexion über den Umweg des Spiegels, das heißt einer Referenz in der dritten Person. Die eigenen Identitäten lassen sich demnach nicht ausbilden, ohne mit Zugehörigkeiten und Abgrenzungen zu arbeiten. Das Individuum muss zunächst die Strukturen wahrnehmen, in denen es sich bewegt und die es hervorgebracht haben, um sich selbst zu reflektieren und beeinflussen zu können. Unsere Identitäten sind nicht alle von vornherein vorgegeben oder ein statisches Ganzes, sie bilden sich aus verschiedenen Faktoren. Wir sind immer auch das, was wir nicht sind.
Im Rückgriff auf Jacques Lacans Spiegelstadium wird umso deutlicher, dass das Spiegelbild dem nie final zu definierenden realen Selbst ein imaginäres Anderes gegenübergestellt, womit es zu einer Verquickung von Wunschbild und Projektionsfläche kommt. Die Erfahrung des gespaltenen Ichs zwischen dem Bild von sich selbst und dem vermeintlichen Abbild im Spiegel sowie die damit verbundenen Projektionen sind es, die dieses Thema für die zeitgenössische Kunst interessant machen.
in Dialog mit

Raphael Weilguni & Viola Relle
Keramikarbeiten, 2021
weitere Beiträge

Chuck Close
Richard, 1969

Fang Lijun 方力钧
Series 1, No. 2, 1990

Johannes Grützke
Tod des Sokrates, 1975

Renato Guttuso
Banchetto funebre con Picasso (aus: Il Convivio), 1973

Megan Rooney
Old baggy root, 2018–2020