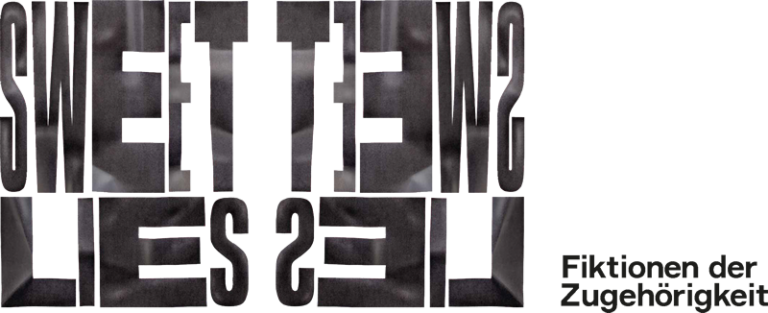Tokenismus
Die Theorie des sogenannten Tokenismus (engl. Tokenism) wurde in den späten 1970er-Jahren von der Soziologin Rosabeth Moss Kanter geprägt. Sie untersuchte die Einstellungskriterien eines Großkonzerns, wobei sie das „Schlupflid-Prinzip“, den Tokenismus, feststellte. Kanter bemerkte, dass Frauen, die in diesem Unternehmen arbeiteten, eine Symbolrolle zukam: Ihre Anstellung diente als Alibi, um das Unternehmen vor Vorwürfen mit Blick auf Sexismus und Ausgrenzung zu bewahren. Man nutzte sie als Repräsentantinnen der Kategorie Frau. Dadurch dass sie zu Repräsentantinnen einer ganzen heterogenen Gruppe wurden, wurden sie nicht mehr als Individuen wahrgenommen. Machte eine dieser wenigen Frauen einen Fehler, wirkte sich dieser Fehler auf die Außenwahrnehmung der ganzen Gruppe aus. War eine Frau hingegen besonders gut in ihrem Arbeitsfeld, schloss man daraus nicht auf die gesamte Gruppe, sondern betrachtete sie als Ausnahmetalent. Damit steht der Tokenismus dem Essentialismus nahe. Gleichzeitig bezieht sich Tokenismus nicht nur auf Frauen in einem von Männern dominierten Umfeld – Mitglieder aller marginalisierten Gruppen können von Tokenismus betroffen sein. Zusätzlich stehen Personen in ihrer Funktion als Stellvertreter*innen unter enormen Erwartungsdruck.